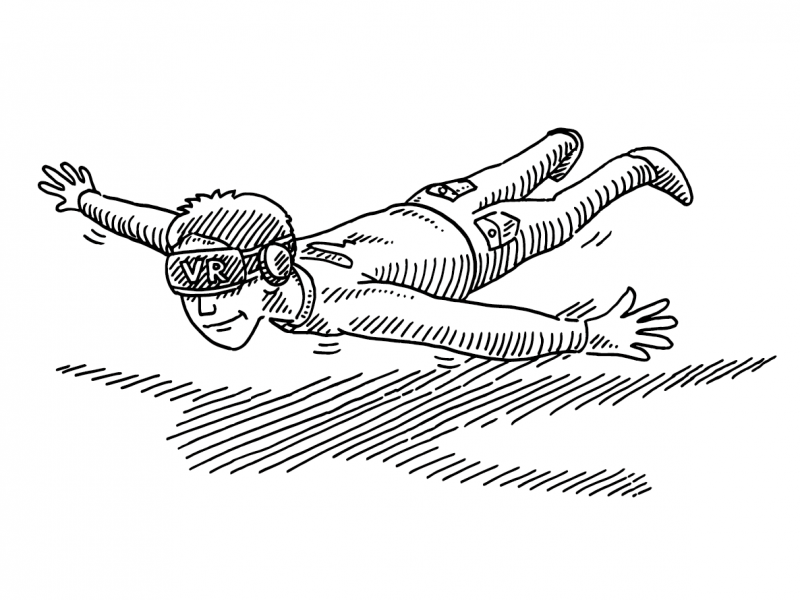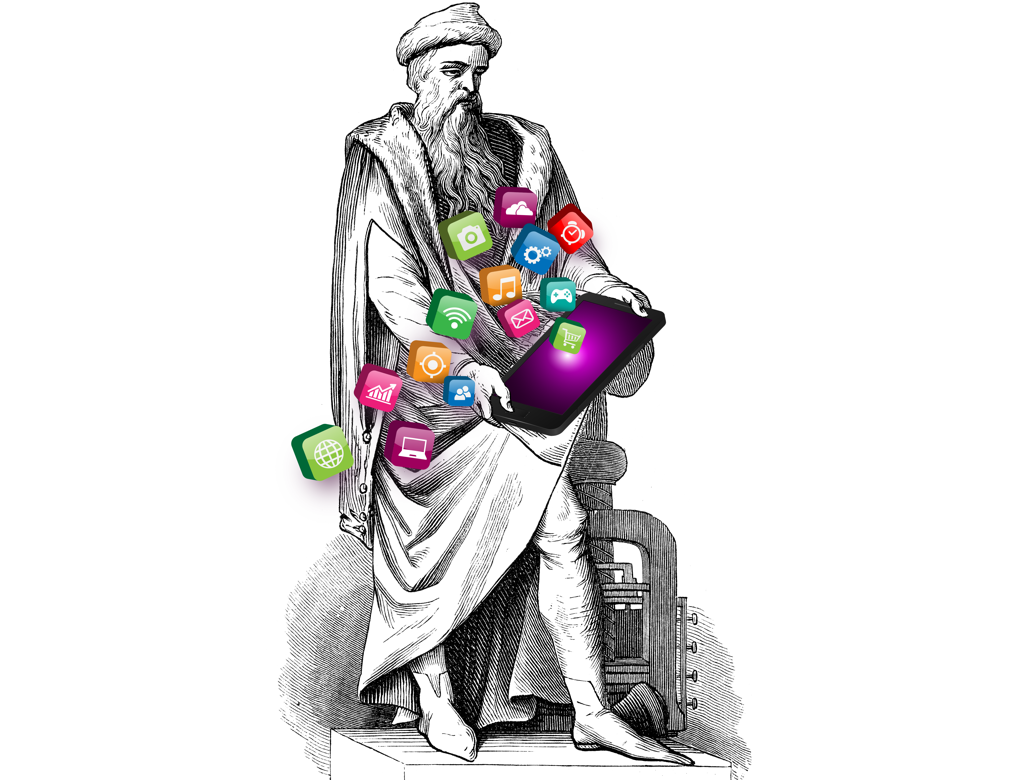 ©iStock.com/benoitb /sarawuth702
©iStock.com/benoitb /sarawuth702
Die Geschichte der Kommunikationstechnologie ist eine Geschichte des Kampfes um Informationsfreiheit. Sie ist eine Geschichte um Macht, Kontrolle und Herrschaft. Sie begann mit der Erfindung des Buchdrucks. Und sie wird nicht im Cyberspace enden.
Kaum hatte Gutenberg seine Druckmaschine erfunden, begann der Streit darüber, wie frei man seine Gedanken und Ideen auf gedrucktem Papier verbreiten kann. Und diese Diskussion wiederholte sich mit jeder Innovation in der Kommunikationstechnologie: Telegraph, drahtlose Telegraphie, Rundfunk, Fernsehen, Computer, Kommunikationssatelliten, Internet. Insofern ist unsere heutige Diskussion, wer was wie im Internet veröffentlichen darf, nicht so fundamental anders, als all die Informationsfreiheits-Debatten der vergangenen 500 Jahre.
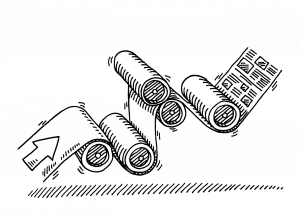 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Vergleicht man die politische Diskussion, die jeder kommunikations-technologischen Innovation folgte, dann ergibt sich ein Muster, das sich wie ein roter Faden durch die Zeitläufe der Kommunikationsgeschichte zieht. Neue Technologien eröffneten neue individuelle Freiräume für Information und Kommunikation mit dem Potential etablierte Machtstrukturen (insbesondere, wenn sie auf einem Informationsmonopol basierten) zu unterminieren. Sie eröffneten auch neue Geschäftsfelder und wurden von unterschiedlichen Gruppen für unterschiedliche Zwecke genutzt. Es dauerte nicht lange und der Staat griff mit mehr oder minder strengen Regularien ein. Die staatliche Einschränkung der technisch gewonnenen Freiräume wurde in der Regel begründet mit der Notwendigkeit des Schutzes von „nationaler Ordnung und Sicherheit“, motiviert in nicht wenigen Fällen aber vor allem mit der Sorge um den eigenen Machterhalt. Das führte nicht selten zu drakonischen Zensurmaßnahmen. Dem folgte dann ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Zensoren und Zensierten, bis die nächste technologische Innovation die mittlerweile etablierten staatlichen Kontrollmechanismen erneut aushebelte.
Das betraf die nationale Kommunikation ebenso wie den grenzüberschreitenden Informationsfluss. Kaum war 1833 der Telegraph erfunden, sicherten sich die Regierungen in völkerrechtlichen Verträgen das Recht, den grenzüberschreitenden Telegraphenverkehr zu unterbinden, sollten Telegramme verbreitet werden, die die „nationale Sicherheit“ gefährden oder „Staatsgeheimnisse“ verraten. Das gleiche wiederholte sich bei der Diskussion zur drahtlosen Telegraphie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Als der Rundfunk aufkam, wurde in den 1920er und 1930er Jahren im Völkerbund über einen „Rundfunkfriedenspakt“ verhandelt. In den 1970er und 1980er Jahren verhandelte die UNO mehr als 15 Jahre über eine Konvention zum Satellitendirektfernsehen.
Beim Internet, so schien es viele Jahre lang, hatten Regierungen die technische Entwicklung verpasst und Zensoren auf Grund der dezentralen Architektur des Internets schlechte Karten. Das Internet entstand und entwickelte sich quasi im Schatten staatlicher Regulierung als ein globales Medium, das die Grenzen von Zeit und Raum, und insofern auch die Grenzen zwischen Staaten, nicht kannte. Das Internet konstituierte sich als ein neues Medium der unbegrenzten Freiheit, gemanagt von der „globalen Internet Community“ (IETF, RIRs, ICANN, IANA, W3C, IAB, ISOC 1) und basierend auf einem innovativen Selbstregulierungskonzept, bei dem alle Betroffenen und Beteiligten (Stakeholder) in einem von unten organisierten, offenen und transparenten Politikentwicklungs- und Entscheidungsprozess gleichberechtigt einbezogen sind. Regierungen sind eher nicht involviert oder allenfalls, wie bei ICANN, in einer Beratungsfunktion tätig.
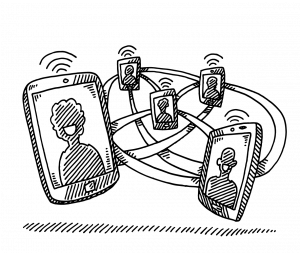 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Anfang der 2000er Jahre signalisierte aber bereits der UN Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS), dass viele Regierungen das Freiheitsversprechen des Internets eher als eine Bedrohung ihrer Machtpositionen wahrnahmen und darauf aus waren, den Geist einer globalen Kommunikationsfreiheit wieder in die Flasche nationaler Regelungen und Kontrolle zurückzubugsieren. Im 1. Ausschuss der UN-Vollversammlung wird seit mehr als zehn Jahren ein russischer Konventionsentwurf zur Cybersicherheit diskutiert, der deshalb nicht vorankommt, weil er einen Paragraphen enthält, der Regierungen ermächtigen soll, Inhalte im Cyberspace zu zensieren, um „nationale Souveränität“ zu schützen.
Wird heute nun das Internet eingeholt von dem jahrhundertealten Debattenmuster über neue Kommunikationstechnologien, Informationsfreiheit und Zensur? Immer mehr Länder – und nicht nur autokratische Regimes – erlassen Internet-Gesetze, die Konsequenzen haben für Meinungsäußerungs- und Kommunikationsfreiheit. Droht eine Re-Nationalisierung, eine Fragmentierung des globalen, offenen und freien Internets? Fakt ist, dass die in den letzten Jahrzehnten gewonnene Internetfreiheit einem bislang nicht gekannten Stresstest ausgesetzt ist. Und noch ist nicht entschieden, wie diese Diskussion ausgehen wird.
Insofern ergibt es Sinn, erneut in die Geschichte zu schauen, um die Mechanismen, die hinter den Interdependenzen zwischen Technologie, Freiheit, Politik, Regulierung und Kontrolle stecken, besser verstehen zu können.
John Miltons „Areopagitica“: Das Recht auf freie Meinungsäußerung
John Miltons 1644 publizierte Streitschrift „Areopagitica“, in der er die Grundzüge unseres heutigen „Rechts auf freie Meinungsäußerung“ entwickelte, war eine Reaktion auf die Erfindung des Buchdrucks.2 Johannes Gutenbergs Druckpresse ebnete den Weg zu einer neuen Dimension der Verbreitung von Ideen und Informationen. Bis ins 16. Jahrhundert dominierte das gesprochene Wort. Schriftstücke wurden mit Hand verfasst und entzogen sich einer massenhaften Verbreitung. Die Druckpresse revolutionierte dieses Kommunikationssystem. Wissen konnte nun in bis dahin unbekannten Größenordnungen festgehalten und vermittelt werden. Immer mehr Menschen erlernten die neue Kulturtechnik, was soziale und wirtschaftliche Veränderungen nach sich zog. Der Weg zum „mündigen Bürger“ war zwar noch lang, aber das Tor war aufgestoßen.
Diese technische Revolution löste bei der herrschenden politischen Elite jener Zeit – der katholischen Kirche und dem feudalabsolutistischen Adel – nicht nur Beifall aus. Zwar bot Gutenbergs Innovation die Möglichkeit, die Worte des „rechten Glaubens“ vielfältiger zu verbreiten, die Druckpresse erlaubte es aber auch Opponenten von Kirche und Adel, ihre Ideen zu veröffentlichen. Zwangsläufig unterminierte dies den Herrschaftsanspruch derjenigen, die behaupteten, über die einzige und absolute Wahrheit zu verfügen. Die Kirche – als der damals wichtigste gesellschaftliche Kommunikationsplatz – erhielt Konkurrenz durch ein zeit- und ortsunabhängiges alternatives Medium.
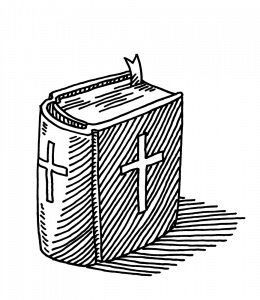 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Um einer Machterosion entgegenzuwirken, wurde ein rigides Zensursystem eingeführt. 1501 ordnete Papst Alexander VI. an, dass jede Druckschrift der Genehmigung des zuständigen Bischofs bedürfe. Das Herstellen und Verbreiten ungenehmigter Schriften wurde kriminalisiert. 1559führte die katholische Kirche den „Index Librorum Prohibitorum“ ein, eine Liste mit den Titeln verbotener Bücher. Bei Missachtung drohten drakonische Strafen. Frankreichs König Franz I. erließ 1535 ein Edikt, das die Herstellung eines nicht genehmigten Buches mit dem Tode durch den Strang bestrafte.
John Milton forderte dieses machtsichernde Kontrollsystem heraus. In der „Areopagitica“ erinnerte er an das alte Griechenland, wo die Bürger Athens täglich auf den Marktplatz gingen und dort nicht nur ihre Einkäufe erledigten, sondern auch Ideen und Informationen austauschten. Der Marktplatz war ein Handelsplatz, aber auch ein Kommunikationsforum, jeder hatte das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Die Konzepte des „freien Handels“ und des „freien Informationsflusses“ haben hier ihre eigentliche Quelle.
John Milton erinnerte in seinem Streit mit den katholischen Zensoren des Mittelalters an dieses natürliche Recht eines jeden Einzelnen. Die Veröffentlichung von Ideen und Informationen in gedruckten Büchern, so Milton, sei doch im Grunde nichts anderes als die Artikulation einer Meinung auf dem „Areopag“. Dieses individuelle Recht auf freie Meinungsäußerung ist, so Milton, ein Naturrecht. Es wird nicht von den Herrschenden gewährt. Eigentümer des Rechts ist der Bürger. Die Rolle des Staates besteht darin, die Ausübung dieses Rechts zu ermöglichen und zu schützen.
Milton war dabei durchaus Dialektiker. Das Interesse, so räumte er andererseits ein, das Regierungen oder die Kirche an gedruckten Schriften haben, sei gleichfalls legitim. Freiheiten könnten in unverantwortlicher Weise missbraucht werden und die Rechte dritter Personen verletzen. „Ich leugne nicht“, schrieb er, „dass es von der größten Wichtigkeit für die Kirche und den Staat ist, ein wachsames Auge darauf zu haben, wie sich Bücher sowohl als Menschen benehmen.“ Man könne jedoch den Teufel nicht mit dem Beelzebub austreiben. Zensur sei keine Medizin, sondern ein Gift. Die Zensur von Ideen und Informationen kann Schäden anrichten, „die größer sind, als wenn ein Feind zur See alle unsere Häfen, Reeden und Buchten sperren würde“, weil Zensur „die Einfuhr unserer kostbarsten Handelsware“ verhindere, die Einfuhr „der Wahrheit“.
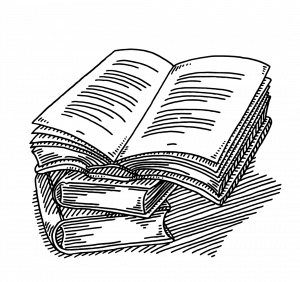 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Miltons Forderung nach einem Recht auf freie Meinungsäußerung spielte eine wesentliche Rolle in den Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts. Das erste Pressefreiheitsgesetz verabschiedete 1766 der schwedische Reichstag. Im 1. Zusatzartikel zur US-amerikanischen Verfassung von 1791 wird dem US-Kongress verboten, Gesetze zu erlassen, die die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Presse einschränken.3 In der 1789 während der französischen Revolution verabschiedeten „Menschenrechtserklärung“ wird das Recht auf freie Meinungsäußerung als ein grundlegendes Menschenrecht definiert das seine Grenzen lediglich dort findet, wo die Rechte und Freiheiten anderer berührt sind. 4
Druckschriften und die Heilige Allianz: Die Karlsbader Verträge von 1819
In Deutschland spielten die Freiheitsideen der französischen Revolution in den 1810er Jahren eine wesentliche Rolle. Es war eine historische Paradoxie, dass es der Begründer des Code Civil, Napoleon Bonaparte, war, in den besetzten deutschen Gebieten ein rigides Zensursystem eingeführt hatte. Auch und gerade gegen diese Zensur richteten sich die Befreiungskriege, die zur Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht von Leipzig 1813 führten. Es waren vor allem die Intellektuellen – Studenten wie Professoren – die beim Wartburgfest 1817 dies als einen Sieg der Freiheit feierten.
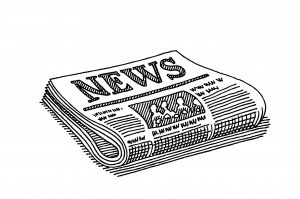 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Die massenhafte Verbreitung von Informationen über Ländergrenzen hinweg beschäftigte auch den Wiener Kongress von 1815. Insbesondere Fürst Metternich drängte darauf, der freien Meinungsäußerung staatlich verordnete enge Grenzen zu setzen. Den die Befreiungskriege begleitenden freien Geist sah Metternich – und mit ihm die „Heilige Allianz“ – als eine Bedrohung der etablierten Machtverhältnisse. Um kritischen Meinungsäußerungen Herr zu werden, vereinbarten die Mitglieder der Allianz in Karlsbad 1819 – sechs Jahre nach Leipzig, vier Jahre nach Waterloo und zwei Jahre nach dem Wartburgfest – ein rigides Zensursystem, das unter anderem Professoren verpflichtete, ihre Vorlesungen genehmigen zu lassen und die Einfuhr „aufrührerischer“ Schriften aus dem Ausland unterbinden sollte.
In seinem „Deutschland, ein Wintermärchen“ spottete später Heinrich Heine über Zollbeamte an den Grenzen des Deutschen Bundes, die in den Postkutschen nicht nur nach „Brüsseler Spitzen und Bijouterien“, sondern auch nach „konfiszierlichen Büchern“ suchten. Die 1848er Revolution, in der die Forderung nach Presse- und Meinungsfreiheit eine zentrale Rolle spielte, fegte die Karlsbader Verträge hinweg. Es war im Übrigen der junge Karl Marx, der 1848 in einem Artikel in der „Neuen Rheinischen Zeitung“ die Pressefreiheit definierte als „das überall offene Auge des Volksgeistes, das verkörperte Vertrauen eines Volkes zu sich selbst, das sprechende Band, das den Einzelnen mit dem Staat und der Welt verknüpft, die inkorporierte Kultur, welche die materiellen Kämpfe zu geistigen Kämpfen verklärt“. 5
Der Telegraph: Die Verträge von Paris und Berlin (1865 und 1906)
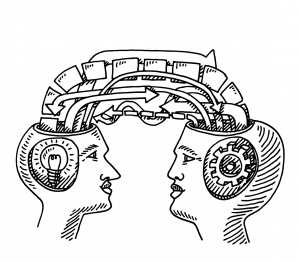 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Die gerade erfundene neue Kommunikationstechnologie des Telegraphen erlaubte eine bis dato nicht gekannte schnelle Verbreitung von Ideen und Informationen. 1849 gründete der jüdische Verleger Bernhard Wolff „Wolffs Telegraphisches Bureau“, eine der ersten Nachrichtenagenturen der Welt, die zu einem wichtigen Träger der Meinungsfreiheit wurde.
Die 1848er Revolution änderte wenig am Interesse der damaligen Regierungen, den Informationsfluss innerhalb eines Landes und zwischen den Ländern zu kontrollieren. Im Gegenteil, die Erfindung des Telegraphen fügte dem Kontrollinteresse eine neue Dimension hinzu. Einerseits sah man den wirtschaftlichen Vorteil, den die Telegraphie mit sich brachte. Anderseits befürchtete man, dass das neue technische Medium benutzt werden könnte, um die Zensurbestimmungen der Karlsbader Verträge umgehen zu können.
1849 schlossen Preußen und Österreich den ersten bilateralen Vertrag, der den Telegraphenverkehr einer strikten staatlichen Kontrolle unterwarf. 1850 wurde er in Dresden in einen multilateralen Vertrag zwischen allen Staaten des Deutschen Bundes umgewandelt. Telegraphie war insofern von Anfang an eine staatliche Angelegenheit, streng kontrolliert von den Regierungen.
Auch das zunächst unabhängige „Wolffs Telegraphisches Bureau“ (W.T.B.) geriet unter staatlichen Druck. 1865 wurde es in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt, die dem preußischen Staat – und damit der Pressepolitik Bismarcks – unterstand. Am 10. Juni 1869 schlossen das W.T.B. und das preußische Staatsministerium einen geheimen Vertrag, der den Einfluss der Politik zementierte: Das W.T.B verpflichtete sich, gegen einen Zuschuss von jährlich 100.000 Talern und eine Bevorzugung bei der Benutzung des Telegraphenbüros, amtliche Depeschen bevorzugt zu behandeln und andere Depeschen den Behörden auf Wunsch vor der Verbreitung vorzulegen.
1865 – mittlerweile war ganz Europa ans Telegraphennetz angeschlossen – lud Kaiser Napoleon III. zu einer Telegraphenkonferenz nach Paris ein, die die internationalen Kontrollmechanismen für einen grenzüberschreitenden Informationsfluss weiter ausbaute.
In Artikel 1 der Internationalen Telegraphenkonvention von 1865 gestehen „die hohen contrahierenden Theile Jedermann das Recht zu, mittelst der internationalen Telegraphen zu correspondieren“ und dabei auch das „Telegraphengeheimnis“ zu wahren. In Artikel 4 aber behalten sie sich das Recht vor, „die Beförderung eines jeden Privat-Telegramms zu verhindern, welches für die Sicherheit des Staates gefährlich erscheint oder gegen die Landesgesetze, die öffentliche Ordnung oder die Sittlichkeit verstößt“ 6
Welche Depeschen für die Sicherheit des Staates gefährlich sein könnten oder gegen die öffentliche Ordnung und die Sittlichkeit verstoßen, dies zu entscheiden, behielten sich die Regierungen selbst vor. Von unabhängigen Gerichten war keine Rede.
Die 1865er Pariser Telegraphenkonvention – die einerseits die Entwicklung der Technologie befördert, sie andererseits aber (was die inhaltliche Komponente und die Ausübung des individuellen Rechts auf freie Meinungsäußerung betrifft) unter strikte Kontrolle des Nationalstaates stellt – wurde zum Modell zukünftiger Regelungen der grenzüberschreitenden Kommunikation. Und sie ist auch das Modell, das im 21. Jahrhundert vielen Regierungen vorschwebt, wenn es um die Regulierung des Internets geht.
Der 17. Mai, der Unterzeichnungstag der Pariser Konvention, wird noch heute von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) als „Weltkommunikationstag“ gefeiert. Und noch heute geht es bei der Auseinandersetzung zwischen der zwischenstaatlichen ITU und ICANN, der privaten Gesellschaft, die das Internet Domain-, Adressen- und Rootserver-System managt, darum, ob und wer die übers Internet verbreiteten Inhalte kontrollieren und zensieren kann.
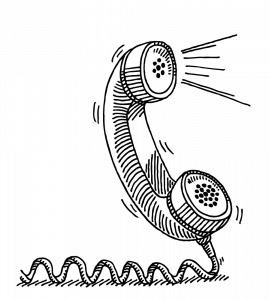 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Die Erfindung der drahtlosen Telegraphie zu Beginn des 20. Jahrhunderts löste die gleiche staatliche Reaktion aus. Die „International Radiotelegraph Convention“, angenommen 1906 in Berlin, folgte der Struktur der Telegraphenkonvention von 1865. Dem Recht auf grenzüberschreitende Verbreitung von Informationen stand das Recht der Staaten gegenüber, diesen Verkehr im Interesse des Schutzes der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung zu kontrollieren und zu unterbrechen.
Der damalige Staatssekretär im deutschen Postministerium Reinhold Kraetke sagte bei der Eröffnung der Berliner Radiotelegraphenkonferenz im Juni 1906, dass „die Ausbreitung der elektrischen Wellen zur radiotelegraphischen Nachrichtenübertragung jedoch nicht von den Staatsgrenzen aufgehalten wird. Jede elektrische Welle, die mit dem nötigen Energieaufwand ausgestrahlt wird, überschreitet diese Grenzen, gleich ob der Bestimmungsort diesseits oder jenseits gelegen ist. Aus diesem Grunde hat die Radiotelegraphie mehr als jedes andere Nachrichtenmittel von Anbeginn an einen internationalen Charakter, der zweifellos eine internationale Ordnung verlangt.“ 7 Und diese geforderte „internationale Ordnung“ basierte auf dem Souveränitätsprinzip das staatliche Kontrolle von Informationsinhalten, einschließlich der Zensur, legitimierte.
Rundfunk: Der Genfer Rundfunkfriedenspakt von 1936
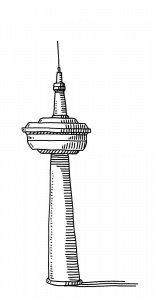 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Nach dem 1. Weltkrieg entwickelte sich der Kurzwellenrundfunk zu einem weiteren grenzüberschreitenden Kommunikationsphänomen. Erneut ergriffen Regierungen die Initiative, um auch hier ein internationales Rechtsregime zu schaffen. Im Grunde gab es für die Regelung des Hörfunks in den 1930er Jahren die gleiche Agenda wie in Karlsbad 1819, in Paris 1865 oder in Berlin 1906: Wie lassen sich die durch technische Medien verbreiteten Inhalte kontrollieren? Wieviel Freiheit kann man erlauben? Wer ist wofür verantwortlich? Welche wirtschaftlichen Aspekte sind dabei zu berücksichtigen?
Mehr als ein Jahrzehnt arbeiteten verschiedene Ausschüsse im Genfer Völkerbund und im Pariser „Institut für intellektuelle Kooperation“, dem Vorläufer der UNESCO, an einer „Radiokonvention“. 8 Erst als in Deutschland die Nazis die Macht ergriffen hatten und Joseph Goebbels begonnen hatte, den Rundfunk in ein Instrument der Massenpropaganda und der Kriegsvorbereitung (und später der Kriegsführung) umzuwandeln, kamen die verhandelnden Regierungen (die USA waren nie Mitglied des Völkerbundes, Deutschland war ausgetreten) zu einem Konsensus.
Die im September 1936 in Genf unterzeichnete „Konvention über den Gebrauch des Rundfunks im Interesse des Friedens“ garantierte einerseits das Recht auf freie internationale Verbreitung von Radioprogrammen im Kurzwellenbereich, verpflichtete aber auf der anderen Seite die Regierungen, Vorsorge zu treffen, damit die Inhalte dieser Radioprogramme dem Frieden und der internationalen Verständigung dienen. Sollten Hörfunksendungen diesen Zielen zuwiderlaufen, stand den Regierungen das Recht zu, den Empfang der Sendungen zu stören und einen internationalen Ehrengerichtshof anzurufen, der nach dem Inkrafttreten der Konvention gegründet werden sollte.
Der „Genfer Rundfunkfriedenspakt“ trat nach Hinterlegung der 30. Ratifikationsurkunde am 30. August 1939 in Kraft. Zwei Tage später, am 1. September 1939, begann der Zweite Weltkrieg. Der sogenannte „Ehrengerichtshof“ wurde nie etabliert. Formell aber ist die Konvention bis heute geltendes Völkerrecht.
Artikel 19 der UN-Menschenrechtsdeklaration: 1948
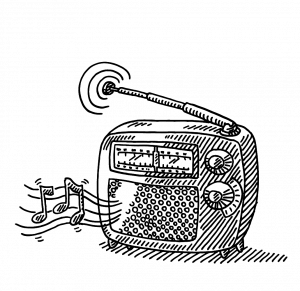 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Massenhaft verletzten die Nazis die Menschenrechte, sie unterbanden den freien Informationsfluss (das Abhören ausländischer Rundfunkprogramme in Deutschland wurde mit hohen Freiheitsstrafen und Deportationen ins KZ bestraft) und missbrauchten die Massenmedien, namentlich den Rundfunk, für Kriegs- und Rassenpropaganda im Zweiten Weltkrieg. Dies war der Ausgangspunkt für die 1945 gegründete UNO, ein neues Herangehen an die internationale Kodifikation von individuellen Rechten und Freiheiten im Bereich von Information und Kommunikation zu fordern.
Bereits auf der 1. UN-Vollversammlung 1946 wurde in der Resolution 59 (I) das Recht auf freie Meinungsäußerung als ein „Eckstein“ der Menschenrechte bezeichnet. In den Statuten zum Nürnberger Internationalen Kriegsverbrechergerichtshof von 1946 wurde auch die Aufhetzung zum Krieg als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit kodifiziert. Auf einer UN-Sonderkonferenz zur Informationsfreiheit, die im April 1948 in Genf begann, sollten Rechte und Freiheiten im Bereich der Information präziser bestimmt werden.
Die Genfer Konferenz wurde bereits vom Kalten Krieg überschattet. Keiner der drei Genfer Konventionsentwürfe (zur Informationsfreiheit, zur Sammlung von Nachrichten und zum Recht auf Berichtigung) wurde verabschiedet. Das einzige Resultat war ein Formulierungsvorschlag für einen Artikel zu einer sich noch im Entwurfsstadium befindenden Menschenrechtsdeklaration. Dieser Vorschlag fand am 12. Dezember 1948 als Artikel 19 Eingang in die „Allgemeine Erklärung über die Menschenrechte“.
Nach Artikel 19 hat jedermann das „Recht auf freie Meinungsäußerung“. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, „Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten“. Dieses Recht wird jedoch in Artikel 29 dem Souveränitätsvorbehalt des einzelnen Staates unterstellt und insofern folgt auch diese Regelung dem Modell der Pariser Telegraphenkonvention von 1865.
Die Menschenrechtsdeklaration ist kein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Erst 18 Jahre später, am 19. Dezember 1966, verabschiedete die UN-Vollversammlung die „Internationale Konvention über die politischen und zivilen Rechte“, deren Artikel 19 weitgehend den Formulierungen von Artikel 19 der Menschenrechtsdeklaration folgt, jedoch eine Reihe von Zusätzen enthält, die insbesondere die Einschränkungsmöglichkeiten betreffen. Demnach kann nach Absatz 3, Artikel 19 der Konvention die Meinungs- und Informationsfreiheit eingeschränkt werden, um die „Rechte und den guten Ruf anderer“ sowie die „nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung, die öffentliche Gesundheit und die Moral“ zu schützen. In Artikel 20 werden die Staaten verpflichtet, per Gesetz Kriegs- und Rassenpropaganda zu verbieten. 9
Diese Einschränkungsmöglichkeiten sind sogenannte Gummiparagraphen. Regierungen, die es mit den individuellen Menschenrechten nicht so genau nehmen und sich nicht unabhängigen Gerichten gegenüber zu verantworten haben, können mit dieser Konstruktion jedwede Zensurmaßnahmen mit Verweis auf behauptete Bedrohungen von nationaler Sicherheit oder öffentlicher Ordnung rechtfertigen. Auch hier stand Artikel 4 der 1865er Telegraphenkonvention Pate.
Satellitendirektfernsehen und neue Weltinformationsordnung
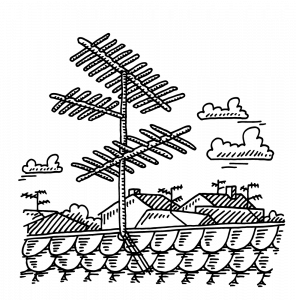 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Mit der nächsten technologischen Innovation, den 1963 in Betrieb genommenen Kommunikationssatelliten, wurde die internationale Debatte um Informationsrechte und Freiheiten in den Weltraum getragen. 1965 wurde der Weltraumvertrag unterzeichnet. Der Vertrag verpflichtet Staaten, den Weltraum nur für friedliche Zwecke zu nutzen. Das schließt Kriegspropaganda via Kommunikationssatellit aus. Noch 1966 begann der UN-Weltraumausschuss, später auch UNESCO und ITU, sich mit der Entwicklung eines zwischenstaatlichen Rechtsregimes für internationale Satellitenkommunikation zu befassen.
Während aber die technischen Fragen – wie die Zuordnung von Frequenzen und Satellitenpositionen auf dem geostationären Orbit – in zwischenstaatlichen Vereinbarungen geregelt wurden, führten in der UNO und der UNESCO die sich abzeichnende Möglichkeit des Satellitendirektfernsehens zu heftigen politischen Kontroversen. Hier ging es um Informationsinhalte.
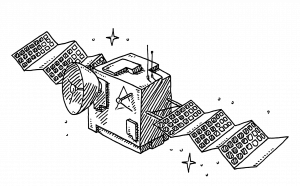 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Die Frontlinien verliefen zwischen der Sowjetunion, unterstützt von den sozialistischen Staaten und der Mehrheit der Entwicklungsländer, und den USA. Die Sowjetunion wollte eine UN-Konvention, die dem Empfangsstaat das Recht zubilligen sollte, darüber entscheiden zu können, ob ausländische Fernsehprogramme von Satelliten für das eigene Territorium abgestrahlt werden können oder nicht (prior consent). Die USA lehnte jedwede staatliche Regulierung zum SDF ab. Einige Staaten – wie Kanada – waren nicht generell gegen einen völkerrechtlichen Vertrag, wollten aber das rigide Prinzip „prior consent“ durch das mehr flexible Prinzip „prior consultation“ ersetzen.
SDF spielte in den 1970er und 1980er Jahren in der ideologisch kontroversen UNESCO-Debatte um eine neuen Weltinformations- und -kommunikationsordnung (NWIKO) eine wesentliche Rolle. 1985 wurde von der 40. UN-Vollversammlung eine unverbindliche Resolution verabschiedet, die den Staaten empfiehlt, bei auftretenden Problemen im Zusammenhang mit über Satelliten ausgestrahlten Fernsehsendungen „in Konsultationen“ einzutreten. Mit dem Aufkommen des Internets Ende der 1980er Jahre verflüchtigte sich aber auch dieses Thema.
Für die Vor-Internet-Zeit kann man aus den Bemühungen zur Schaffung einer internationalen Ordnung für grenzüberschreitende Information und Kommunikation fünf Schlussfolgerungen ziehen:
- Jeder neuen technischen Entwicklung im Bereich der Medien folgten diplomatische Verhandlungen zwischen Regierungen, die in der Regel zu völkerrechtlich verbindlichen zwischenstaatlichen Verträgen führten.
- Kernstück aller Verträge war neben wirtschaftlichen und technischen Regelungen die Frage des Inhalts der Information und der Grad der Freizügigkeit für ihre Verbreitung bzw. die Möglichkeit der staatlichen Kontrolle von Information und Kommunikation.
- Die Möglichkeiten der Staaten, die grenzüberschreitende Kommunikation zu kontrollieren, schwanden mit jeder technischen Innovation. Während es relativ einfach war, die Verbreitung von Druckschriften zu kontrollieren, war es schon komplizierter und kostspieliger, terrestrische Rundfunksendungen oder Kommunikationssatelliten zu stören.
- Mit der Komplexität der Kommunikationstechnologien wuchs die Komplexität völkerrechtlicher Vertragsverhandlungen, wobei sich gleichzeitig die Felder für einen Konsensus verringerten.
- Die Ausarbeitung von Regeln für grenzüberschreitende Kommunikation war ein staatliches Privileg. Wirtschaft, Zivilgesellschaft oder technische Community waren allenfalls indirekt als Berater oder Lobbyisten beteiligt.
Das Internet: Globalisierung vs. Re-Nationalisierung
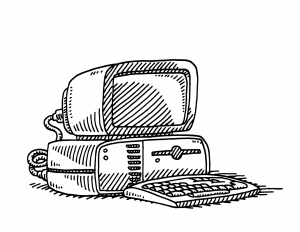 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Das Internet, so schien es zumindest über ein halbes Jahrhundert lang, entzog sich weitgehend den Mechanismen direkter staatlicher Kontrolle. Internetkommunikation fand natürlich nie in einem rechtsfreien Raum statt. Was offline illegal war, wurde nicht legal, wenn es online stattfand. Netzbürger (Netizens) blieben Staatsbürger (Citizens) und Internetserver operierten unter einer nationalen Jurisdiktion.
Die dezentrale technische Architektur des Internets aber, die territoriale Grenzen nicht kennt, hebelte die etablierten Regelungen und Kontrollmechanismen, die für die Kommunikationstechnologien des Industriezeitalters geschaffen waren, aus. Diese alten Technologien waren national organisiert, hierarchisch aufgebaut und zentralisiert. Die Besetzung einer Redaktion, eines Rundfunksenders oder des Telegraphenamtes reichte in kritischen politischen Situationen aus, um die nationale Kommunikation zu kontrollieren. Es gab Presse-, Rundfunk- und Telekommunikationsgesetze. Das Internet kennt kein Zentrum, das man „besetzen“ oder „kontrollieren“ könnte. Selbst über das „Root Server System“ kann man keine Kontrolle ausüben. Die sogenannte „Macht“ im Internet ist dezentralisiert und befindet sich an den „Enden“ des Netzes, dasheißt de facto bei den vier Milliarden Nutzern. Regierungen taten sich daher bis in die jüngste Zeit hinein schwer, die global aufgestellte Internetkommunikation in einem nationalen „Internet-Gesetz“ zu regeln.
Ein Grund dafür war auch, dass im Unterschied zum Rundfunk und zur Telekommunikation, die als nationale staatliche Einrichtungen begannen und erst später privatisiert wurden, Internetunternehmen von Anfang an global aufgestellte private Unternehmen waren. Dazu kam, dass die technische Internetcommunity hochgradig selbstorganisiert war. Die Community etablierte sich bereits in den 1970er und 1980er Jahren, lange bevor das Internet eine wirtschaftliche oder gar politische Bedeutung erlangte. Notwendige Internetregelungen waren primär technischer Natur und wurden von der Community selbst aufgestellt. Die 1969 gestarteten sogenannten „Request for Comments (RFC)“, eine Sammlung kodifizierter technischer Standards, entwickelten sich zum „Gesetzbuch des Internets“.
Die Internetpioniere und ihre Philosophen – von Vint Cerf und Bob Kahn über Nicholas Negroponte und Manuel Castells zu John Perry Barlow und Lawrence Lessig, sahen im Cyberspace das Entstehen einer neuen Welt, die auch nach neuen Regeln funktioniert. „Code is Law“ schrieb Harvard Professor Lessig Ende der 90er Jahre. Und in der Davoser „Unabhängigkeitserklärung für den Cyberspace“ von 1996entwickelte Barlow die Utopie einer partizipatorischen Cyberdemokratie.
Die in den 1990er Jahren in den USA amtierende Administration unter Präsident Bill Clinton förderte diese Sichtweise. Sie hielt das Internet weitgehend regelungsfrei, um das wirtschaftliche Potential der neu entstehenden digitalen Wirtschaft nicht frühzeitig zu strangulieren. Die Politik der „genehmigungsfreien Erfindung“ (Innovation without Permission) funktionierte und ermöglichte das Entstehen der Internetgiganten des Silicon Valley. Das Multistakeholder-Prinzip, auf denen die globalen Internetorganisationen wie ICANN basieren, funktioniert de facto nach den Regeln einer partizipativen Demokratie. Jeder kann sich in die offenen und transparenten Prozesse einbringen. Entschieden wird nicht nach einfacher Mehrheit. Der IETF Slogan von 1993 – We do not believe in kings, presidents and voting, we believe in running code and rough consensus – gilt bis heute als Leitmotiv für das Internet.
Das Internet Governance Modell mit seinem Multistakeholder-Ansatz – das heißt der Beteiligung von Wirtschaft, technischer Community and Zivilgesellschaft an der Ausarbeitung und Umsetzung von Internetpolitiken – förderte die Globalisierung des Internets und das Wachsen der Internetcommunity von vier Millionen auf vier Milliarden Nutzer in einem Zeitraum von 25 Jahren. Jeder der vier Milliarden kann heute mit jedem jederzeit in Wort, Ton, Bild oder Video ungeachtet von Grenzen kommunizieren. Die Utopie von Artikel 19 der UN-Menschenrechtserklärung ist Wirklichkeit geworden.
Als Anfang der 2000er Jahre das Thema Internet Governance zum Streitpunkt beim UN Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS) wurde – China forderte staatliche Kontrolle, die USA „private sector leadership“ – machte UN-Generalsekretär Kofi Annan einen Kompromissvorschlag. Das Internet sei eine technische Innovation, sagte er auf einer Rede in New York 2003. Warum sollte also diese neue Technologie nicht durch eine „politische Innovation“ gemanagt und geregelt werden? 10
Die von ihm eingesetzte UN Working Group on Internet Governance (WGIG) erarbeitete eine Definition, die 2005 Eingang fand in den „Tunis Agenda“ des UN-Weltgipfels. Diese Definition weist sowohl staatliche Kontrolle als auch „private sector leadership“ zurück und etabliert als politische Innovation das Multistakeholder-Prinzip, nach dem alle Betroffenen und Beteiligten in ihren jeweiligen Rollen in Politikentwicklung und Entscheidungsfindung eingebunden sein sollten. 11 Insofern war der WSIS eine wesentliche Weichenstellung für die Zukunft einer globalen Internetregulierung.
Der Weltgipfel bestätigte jedoch auch das Prinzip der nationalen Souveränität und bekräftigte das Recht von Regierungen, eine nationale Internetpolitik zu entwickeln. Dieser Widerspruch zwischen Globalisierung und (Re-)Nationalisierung hat im letzten Jahrzehnt die weltweite Internetdiskussion bestimmt.
Einerseits hat sich der Multistakeholderismus weiterentwickelt:
- Das vom WSIS gegründete Internet Governance Forum (IGF) hat sich zur einer globalen Multistakeholder-Plattform entwickelt, auf der alle politisch relevanten Internetthemen zwischen allen Stakeholdern auf gleicher Augenhöhe diskutiert werden.
- Die Internetweltkonferenz „Net Mundial“, die die brasilianische Regierung nach den Enthüllungen von Edward Snowden im April 2014 in São Paulo veranstaltete, verabschiedete eine „Allgemeine Erklärung zu Grundprinzipien für Internet Governance“, die nicht nur von weit über 100 Regierungen, sondern auch von den großen Internetunternehmen des Silicon Valley, der Zivilgesellschaft und der technischen Community mit ausgehandelt und mitgetragen wurde. Das erste Prinzip dieser Deklaration ist, dass Internet Governance auf der Beachtung der Menschenrechte, darunter des Rechts auf freie Meinungsäußerung, basieren muss.
- 2016 entließ die US-Regierung ICANN aus ihrer Obhut. Die kritischen Internetressourcen – Domainnamen, IP-Adressen, Root Server – werden jetzt von einer auf dem Multistakeholder-Prinzip basierenden globalen Internetgemeinschaft selbst verwaltet. Regierungen sind in ICANN lediglich in einer beratenden Funktion involviert, haben aber keine Entscheidungsmacht.
Andererseits aber haben die Anstrengungen zu mehr Regierungskontrolle und einer Re-Nationalisierung des Internets zugenommen. Mehr als 70 Länder haben in den letzten Jahren teils rigide Internet-Kontrollgesetze verabschiedet. China plädiert für die Anerkennung des Prinzips einer nationalen Cybersouveränität, Russland hat das Konzept eines notwendigen Schutzes des „nationalen Internet Segments 12“ in die UNO eingebracht. Angesichts neuer Gefahren – Cyberterrorismus, Cyberkrieg, digitalen Handelsbarrieren – haben auch immer mehr demokratische Staaten Gesetze verabschiedet, die zu einer größeren Regelungsdichte für das Internet führen und die im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit angesiedelt sind. Es droht eine Fragmentierung des Internets. 13
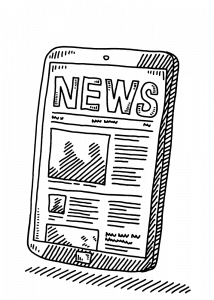 ©iStock.com/FrankRamspott
©iStock.com/FrankRamspott
Es gehört nicht viel Phantasie dazu um vorauszusagen, dass die 2020er Jahre zu einer heftigen internationalen Auseinandersetzung über ein globales Regime zum Internetmanagement führen werden. Die politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Gegensätze zwischen den Cybersupermächten USA, China, Russland, Brasilien, Indien und der EU sind von Jahr zu Jahr größer geworden. Möglicherweise ist das etablierte UN-System zwischenstaatlicher Organisationen nicht flexibel genug, um darauf die richtigen Antworten zu finden. Inspiration könnte man vom Helsinki-Prozess der 1970er Jahre erhalten. Könnte eine „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Cyberspace“ (KSCC) eine Option sein, wenn sie global aufgestellt ist und staatliche wie nichtstaatliche Stakeholder mit einbezieht? 14
Ob diese Diskussion zurückfällt in die Muster der Kommunikationskontrolle des 18. und 19. Jahrhunderts, oder ob wir – wie von Kofi Annan vorgeschlagen – politische Innovation sehen, die auf der Beachtung der Menschenrechte basiert, ist eine offene Frage. Marschieren wir in Richtung eines Cyberkrieges oder gelingt uns eine neue Cyberentspannung? 15 Entschieden wird das auch vom Engagement aller betroffenen Stakeholder.